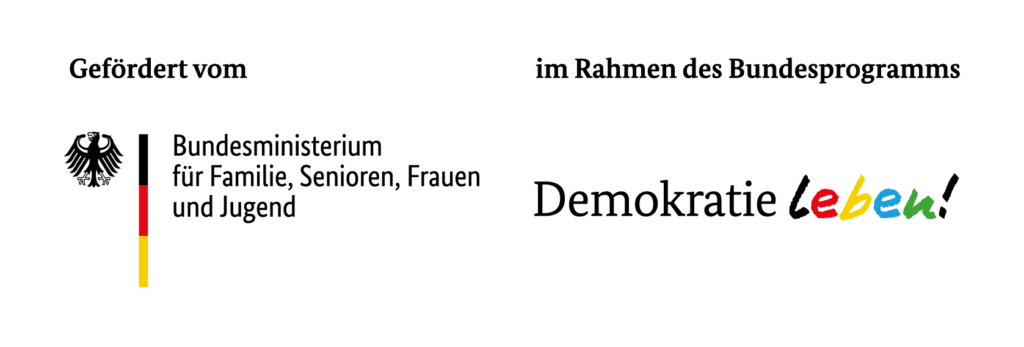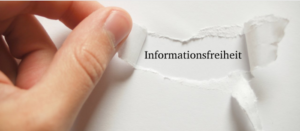 Im Jahr 2006 verabschiedet, bislang unangetastet: das Informationsfreiheitsgesetz. Bundesbehörden und andere Bundesorgane sind in der Pflicht, Auskunft über ihre Arbeit zu geben. Der Presse und allen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen. Sie können darauf drängen, dass Kommunikation und Dokumente publik gemacht werden, die öffentliche Stellen nicht unbedingt freiwillig veröffentlicht sehen wollen. Das Gesetz hat sich als bedeutsames Werkzeug erwiesen, Öffentlichkeit über Behördenhandeln herzustellen – eine demokratische Errungenschaft.
Im Jahr 2006 verabschiedet, bislang unangetastet: das Informationsfreiheitsgesetz. Bundesbehörden und andere Bundesorgane sind in der Pflicht, Auskunft über ihre Arbeit zu geben. Der Presse und allen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen. Sie können darauf drängen, dass Kommunikation und Dokumente publik gemacht werden, die öffentliche Stellen nicht unbedingt freiwillig veröffentlicht sehen wollen. Das Gesetz hat sich als bedeutsames Werkzeug erwiesen, Öffentlichkeit über Behördenhandeln herzustellen – eine demokratische Errungenschaft.
Ist es in einer demokratischen Gesellschaft nicht selbstverständlich, dass staatliche Stellen in ihrem Tun und Handeln transparent sind? Meike Laaf fragt in der ZEIT: „Ist es wirklich eine so kühne Idee, von staatlichen Behörden zu verlangen, dass sie Bürgerinnen und Bürgern auf Anfrage zeigen, was sie tun? Und das im Idealfall auch noch zu erklären? Braucht es genau das heute nicht dringender denn je?“
Nein, sagten einige Verhandlungsführer der laufenden Koalitionsverhandlungen und schrieben in ihr Verhandlungspapier: „Das Informationsfreiheitsgesetz in der bisherigen Form wollen wir hingegen abschaffen.“ Eine Arbeitsgruppe unter Leitung des konservativen Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor hatte die Idee dazu.
Ausgerechnet Amthor, unken derzeit Kommentatoren landauf landab und verweisen darauf, dass eben dieses Informationsfreiheitsgesetz dem ehrgeizigen Politiker vor Jahren einmal einen herben Karriereknick beschert hat.
Das Informationsfreiheitsgesetz steht einer demokratischen Öffentlichkeit gut zu Gesicht. Zahlreiche Skandale wären ohne das Regelwerk vor der Öffentlichkeit verborgen und unaufgeklärt geblieben. Seit Bestehen des Gesetzes sind allein über 300.000 Anfragen über die Frageplattform „Frag den Staat“ gestellt worden.
In einer Zeit, in der viele Menschen sich von Staat und Politik abwenden, vielmehr populistischen Rattenfängern auf den Leim gehen, erweist sich politisch gewollte und praktizierte Transparenz staatlichen Handelns als Gegenbeweis zu bürgerabgewandter Verschlossenheit autoritärer Herkunft.
Im Kommentar bei ZEIT-Online heißt es dazu weiter: „Eine Abschaffung oder auch nur eine Schwächung des Informationsfreiheitsgesetzes in seiner jetzigen Form wäre ein deutlicher Rückschritt. Es wäre ein unglückliches Symbol in einer Zeit, in der es um das Vertrauen in Staat und Politik ohnehin nicht zum Besten steht.“
Und in der „Welt“ rät Benjamin Stibi: „Und wer als Bürger nicht stillschweigend hinnehmen möchte, dass seine Rechte in paternalistischer Weise beschränkt werden, sollte umgehend Kontakt zu seinen Unions- oder SPD-Abgeordneten aufnehmen.“
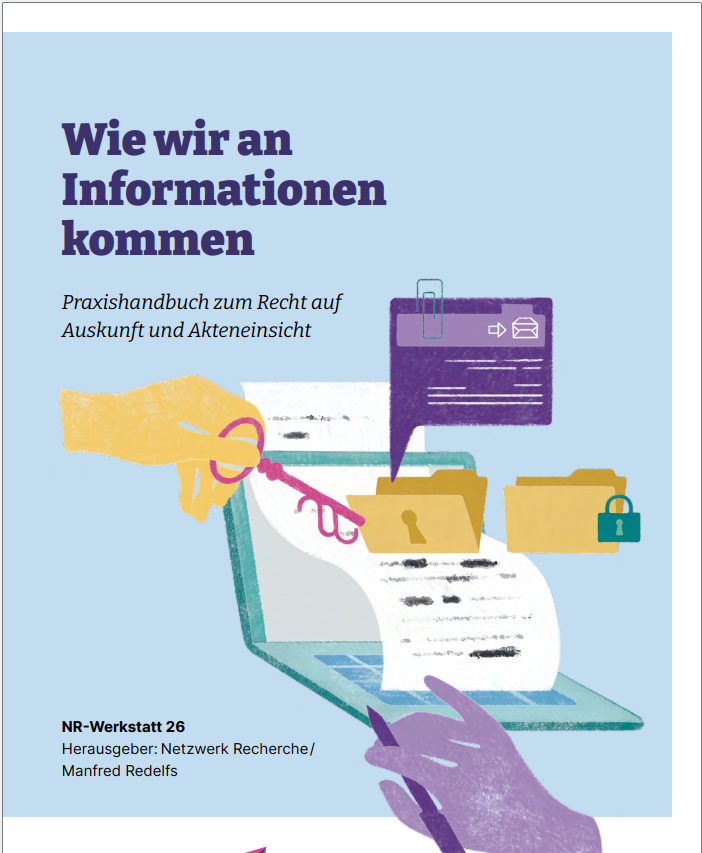
In der Reihe der „Netzwerk Recherche-Werkstätten“ ist
die Publikation „Wie wir an Informationen kommen.
Praxishandbuch zum Recht auf Auskunft und
Akteneinsicht” im Juli 2024 erschienen.
– Informationsfreiheitsgesetz (Bundeszentrale für politische Bildung)
– Demokratie braucht Transparenz (ZEIT-Online)
– Frontalangriff auf die Bürger (t-online)
– Jetzt soll die Transparenz verschwinden (t-online)
– Union plant Abschaffung des Informationsfreiheitsgesetzes (Netzwerk Recherche)
– Amthors Rache (taz)
– Bürgerfragen unerwünscht (Kontext: Wochenzeitung)
Nachtrag:
Im jetzt verabschiedeten Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD zur 21. Legislaturperiode „Verantwortung für Deutschland“ heißt es nunmehr: „Das Informationsfreiheitsgesetz in der bisherigen Form wollen wir mit einem Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung reformieren.“
Ob sich der Ratschlag des „Welt“-Autors Benjamin Stibi (s.o.) damit erübrigt, bleibt angesichts der wenig erhellenden Absichtsäußerung abzuwarten.